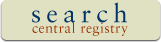News:
Provenienzforschung ist erfolgreich
Vor drei Jahren hat die Berliner Arbeitsstelle für Provenienzforschung ihre Arbeit aufgenommen. Inzwischen werden mehr Kunstwerke und Kulturgüter auf ihre Herkunft untersucht denn je. Heute gab die Zentral- und Landesbibliothek 13 Bücher an die Jüdische Gemeinde in Berlin zurück. Sie erinnerte damit an "Unrecht, das nie verjährt".
 Ein Buch, das an Unrecht erinnert, das nie verjährt Foto: REGIERUNGonline/Eckel
Ein Buch, das an Unrecht erinnert, das nie verjährt Foto: REGIERUNGonline/Eckel
Die Berliner Jüdische Gemeinde ist in der Zeit des Nationalsozialismus vollständig ausgelöscht worden. Ihre Mitglieder wurden ermordet, deportiert oder vertrieben, ihre Einrichtungen zerstört.
Bei umfangreichen Recherchen hat die Berliner Zentral- und Landesbibliothek in ihren Beständen auch einzelne Werke aus diesen Einrichtungen entdeckt. Heute hat sie dreizehn, in der NS-Zeit geraubte, Bücher an die Jüdische Gemeinde zurückgegeben.
Dabei handelt es sich nicht um Bücher, bei denen der künstlerische oder materielle Wert im Vordergrund steht. Gerade ihre Alltäglichkeit sei es, die an die schreckliche Realität der Judenverfolgung in der Nazidiktatur erinnere, erklärte Kulturstaatsminister Bernd Neumann bei der Übergabe der Bücher im Berliner Centrum Judaicum.
Für die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Lala Süsskind ist die Rückgabe ein Zeichen - nach innen und nach außen an die jüdische und die nichtjüdische Gesellschaft. Die Übergabe erinnere uns alle daran, dass Unrecht auch nach so vielen Jahren nicht verjährt.
Verstärkte Suche nach NS-Raubkunst
Die Zentral- und Landesbibliothek sucht seit zehn Jahren in ihren Beständen nach NS-Raubgut. Bisher wurden 25.000 Bücher bearbeitet und 5.100 als verdächtig eingestuft. 1.500 Fälle von NS-Raubkunst sind inzwischen in der "lostart"-Datenbank verzeichnet, mehr als 100 Bücher wurden zurückgegeben.
In den vergangenen zwei Jahren konnte die Bibliothek ihre Nachforschungen noch verstärken. Ermöglicht haben dies das Land Berlin und die Berliner Arbeitsstelle für Provenienzrecherche/-forschung.
Förderung für Projekte in öffentlichen Einrichtungen
Die Arbeitsstelle ist 2008 auf Initiative des Kulturstaatsministers als Teil der Stiftung Preußischer Kulturbesitz eingerichtet worden. Sie unterstützt öffentliche Museen, Bibliotheken und Archive bei der Identifizierung von Kulturgütern, die in der NS-Zeit ihren rechtmäßigen Eigentümern geraubt oder durch deren Verfolgung entzogen wurden.
Die Arbeitsstelle erhält jährlich 1 Million Euro aus dem Haushalt des Kulturstaatsministers. Mittel, die sie öffentlichen Einrichtungen nach einem Antragsverfahren für die projektbezogene, dezentrale Provenienzrecherche zur Verfügung stellt. Die Kulturstiftung der Länder unterstützt die Arbeitsstelle mit weiteren 200.000 Euro jährlich.
Positive Bilanz
Bisher hat die Arbeitsstelle 69 Rechercheprojekte in 58 öffentlichen Einrichtungen gefördert. 28 Projekte konnten inzwischen abgeschlossen werden. Fünf geförderte Einrichtungen haben Kulturgüter zurückgegeben, zahlreiche Verdachtsfälle wurden an die „lostart“- Datenbank gemeldet. Da Fördermittel nur bei Mitfinanzierung durch die Projektträger vergeben werden, kamen weitere 1,2 Millionen Euro aus den Haushalten der Länder und Kommunen der Provenienzrecherche zugute.
Bund setzt Förderung fort
Die Provenienzrecherche habe in Deutschland einen gewaltigen Sprung nach vorn gemacht, freute sich Kulturstaatsminister Bernd Neumann. Inzwischen finde sie international große Anerkennung.
Dennoch müsse noch viel mehr geforscht werden. Deshalb werde er die Arbeit der Arbeitsstelle auch in den nächsten drei Jahren mit einer Million jährlich unterstützen, erklärte Neumann. Er wünsche sich, dass noch mehr kleine und kommunale Einrichtungen das Angebot auf Förderung, Beratung und Vernetzung annehmen. Gleichzeitig erwarte er, dass die Länder ihre großen Einrichtungen so ausstatten, dass sie schließlich selbst die Provenienzforschung weiter betreiben können.