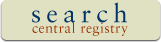News:
Wann gibt es endlich Resultate? - When will we finally see results?
von Stefan Koldehoff
Ende der Woche soll endlich eine Stiftung zur Raubkunstaufklärung gegründet werden: Die Regierung gibt Millionen aus für die Forschung. Nur die Erben kommen nicht zu ihrem Recht.

Möglicherweise Raubkunst: Paul Klees „Federpflanze“ im Düsseldorfer Museum
Die Zahlen, die in den vergangenen Tagen von unterschiedlichen Institutionen veröffentlicht wurden, sind für die deutsche Museumswelt nicht angenehm. Fast zwei Drittel der deutschen Kunsthäuser haben ihre Bestände noch immer nicht auf NS-Raubkunst-Verdacht hin untersucht, teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters im Rahmen der Generaldebatte im Deutschen Bundestag mit. Und nur in einem Zehntel der Institute stünden Mittel für die Suche nach Kunstwerken und Kulturgütern zur Verfügung, die ihren legitimen Eigentümern nach 1933 abgepresst oder gestohlen worden sind.
Schon im Frühjahr hatte Isabel Pfeiffer-Poensgen, Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder, in einem Aufsatz ähnliche Zahlen wie Grütters genannt und festgestellt: „Der Beratungsbedarf ist weiterhin sehr hoch, wie eine Umfrage des Instituts für Museumsforschung gerade ergab - nur jedes dritte Kunstmuseum, das sich bei der Umfrage beteiligte, kennt die Fördermöglichkeiten der Berliner Arbeitsstelle, bei den Volkskunde- und Heimatmuseen nur jedes fünfte, ähnlich sieht es bei den naturkundlichen Museen und den naturwissenschaftlichen und technischen Museen aus.“ Die von ihr geleitete Stiftung stellt über die Berliner Arbeitsstelle Provenienzforschung auf Antrag Mittel zur Verfügung, mit denen Museen die Aufarbeitung ihrer Vergangenheit angehen können.
Der Verweis auf angeblich fehlende Mittel in Ländern und Kommunen ist deshalb schon seit langem kein Argument mehr, sich dieser Aufgabe immer noch zu entziehen - einer Aufgabe, die, wie gerade eine vorbildliche Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg zeigt, eben längst nicht nur die Kunstmuseen betrifft. Das von Grütters geplante „Deutsche Zentrum Kulturgutverluste“ scheint mehr als nötig. Unter seinem Dach sollen dann zahlreiche Arbeitsstellen zum Thema vereint, ihre Arbeit effektiver organisiert und die Ergebnisse transparenter als bisher veröffentlicht werden. Sechzehn Jahre nach der „Washingtoner Erklärung“, in der sich die deutschen Museen in öffentlicher Trägerschaft zur Öffnung ihrer Archive, zur Suche nach und zur Rückgabe von identifizierter Raubkunst verpflichtet haben, fällt die deutsche Bilanz in Sachen NS-Raubkunst zwar deutlich positiver aus als noch vor einigen Jahren.
Täuschung der Öffentlichkeit
Entsprechend rangiert die Bundesrepublik in einer aktuellen Erhebung von Jewish Claims Conference und World Jewish Restitution Organization über die Aktivitäten der 44 Unterzeichnerstaaten von Washington zusammen mit Tschechien, den Niederlanden und Österreich ganz oben. Mehr und mehr Museen sind inzwischen bereit, sich endlich ihrer historischen Verantwortung zu stellen. Zahlreiche „faire und gerechte Lösungen“, wie sie die „Washingtoner Erklärung“ von 1998 fordert, wurden gefunden: Manche Kunstwerke wurden an ihre legitimen Eigentümer zurückgegeben, manche konnten in den Museen hängen bleiben, in die sie irgendwann fanden.
Gar nicht alle Einigungen wurden der Öffentlichkeit bekannt. Trotzdem war die Zahl von angeblich 12.200 Restitutionen, mit denen die „Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste“ in Magdeburg Anfang des Jahres die eigene Arbeit in positivem Licht darstellen wollte, eine maßlose Täuschung der Öffentlichkeit: Die Plakatsammlung des jüdischen Chemikers Hans Josef Sachs wurde in Magdeburg nicht als eine, sondern als 4200 Restitutionen gezählt. Und als erfolgreiche Restitution gewertet, obwohl erst der Bundesgerichtshof die Rückgabe durch das Deutsche Historische Museum in Berlin anordnen musste.
Auch das Flechtheim-Projekt von fünfzehn großen Museen in Deutschland, denen zum Teil seit langem Rückgabebegehren der Erben des großen jüdischen Kunsthändlers Alfred Flechtheim vorliegen, war kein Beleg für eine neutrale Befassung mit dem Thema und kein Ruhmesblatt für die Branche: Zu deutlich war zu bemerken, dass es auch darum gehen sollte, eine Verweigerungshaltung gegenüber den Restitutionsforderungen mit vermeintlich wissenschaftlichen Mitteln zu begründen - ohne dabei aber beispielsweise die Flechtheim-Erben und deren Recherchen auch nur einzubeziehen. Eine geplante Begleitpublikation wird dem Vernehmen nach immerhin wider Erwarten nicht als Publikation der Magdeburger Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste und damit auch nicht als Publikation mit dem Segen der Bundesregierung erscheinen.
Keine Zeit, kein Personal, kein Geld
Über eins jedenfalls kann sich nicht beschweren, wer sich mit dem Thema NS-Raubkunst und Restitution befasst: über zu wenige Publikationen und über zu wenige Tagungen. Allein in diesem Herbst fanden und finden sie wieder in Winterthur, in Cambridge und in New York statt, in Boston und in Krakau. Wieder konnten jene Kunsthistoriker, Juristen und anderen Experten Dienstreisen beantragen, die sich schon seit Jahren überall auf der Welt zu diesem Thema treffen. Ursprünglich hatte die 1998 in Washington angestoßene Provenienzforschung allerdings ein ganz anderes Ziel als die Versorgung des akademischen Betriebs mit Themen und Fördermitteln. Ursprünglich sollte es darum gehen, die Familien beraubter und ermordeter NS-Opfer bei der Suche nach ihrem ehemaligen Eigentum aktiv zu unterstützen.
Daraus geworden ist ein eigener akademischer Betrieb, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses ursprüngliche Ziel zunehmend aus den Augen zu verlieren scheinen. Der aus sich heraus Arbeitsstellen, Fördertöpfe und Dissertationsthemen generiert, dafür gelegentlich Archivbestände für Anwälte und freie Rechercheure sperrt oder nur willkürlich und selektiv freigibt und auf diese Weise die Anspruchsteller, die 1998 in Washington in ihre ursprünglichen Rechte wiedereingesetzt werden sollten, als lästige Bittsteller abfertigt. Für viele von ihnen scheint nicht Kant, sondern Kafka Herr des Verfahrens zu sein. Wer nach dem ursprünglichen Ziel der Provenienzforschung fragt, der Zusammenarbeit mit und der Hilfe für Opfer des Nationalsozialismus und ihre Familien, erhält nach wie vor oft ausweichende Antworten.
Was sie in Sachen Provenienzforschung seit 1998 unternommen und erreicht hätten, wollte der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, der New Yorker Unternehmer und Kunstsammler Ronald S. Lauder, im Frühjahr von 75 zufällig ausgewählten deutschen Museen wissen und hatte ihnen deshalb einen Fragebogen zugesandt. Die bislang unveröffentlichten Antworten, die dieser Zeitung vorliegen, spiegeln die gesamte Bandbreite des deutschen Engagements wider: Einige Museen agieren vorbildlich; andere zählen jene Gründe auf, mit denen seit Jahren fehlende Provenienzforschung begründet wird: keine Zeit, kein Personal, kein Geld; und manche gestehen ganz freimütig ein, dass sie immer wieder neue Werkverträge abschließen, ohne zu begreifen, dass kontinuierliche Aufarbeitung auf diese Weise nicht möglich ist.
Eine Taskforce zur Aufarbeitung
Auch dass der Faktor Zeit für die zum Teil hochbetagten Anspruchsteller eine große Rolle spielt, scheint nicht allen Verantwortlichen in den deutschen Museen bewusst zu sein. In der landeseigenen „Kunstsammlung NRW“ in Düsseldorf verkündete Direktorin Marion Ackermann zwar schon vor fast zwei Jahren, über die Rückgabe dreier Gemälde, die die Erben von Alfred Flechtheim zurückfordern, müsse notfalls auch entschieden werden, wenn nicht alle Fragen geklärt werden können: „Das sind wir den Erben, die nicht mehr die Jüngsten sind, schuldig.“
Seither allerdings ist immer wieder die Rede davon, erst wolle man noch versuchen, das Archiv des Galeristen Daniel-Henry Kahnweiler in Paris einzusehen. Das allerdings ist in Privatbesitz und nicht öffentlich zugänglich. Auf wiederholte Nachfragen der Erbenvertreter, ob Ackermann inzwischen Zugang habe oder wie die Liste der Fragen aussehe, die sie an das Archiv habe - vielleicht könne man ja selbst zur Klärung beitragen -, gab es nicht einmal eine Antwort. Auch der Termin für eine Entscheidung über eine von der Direktorin vor fast zwei Jahren angekündigte Anrufung der Limbach-Kommission wird nicht genannt. Ihre Aussage vom Herbst 2012 habe aber nach wie vor Bestand, teilt Marion Ackermann auf Anfrage mit.
Wer nun gehofft hatte, am deutschen Umgang mit der Raubkunstfrage werde sich durch den vor einem Jahr bekanntgewordenen Fall Gurlitt etwas ändern, wurde inzwischen enttäuscht. Zwar haben die Bundesregierung und das Land Bayern eine eigene „Taskforce“ zur Aufarbeitung jener Kunstwerke eingesetzt, die beim inzwischen verstorbenen Kunsthändlersohn Cornelius Gurlitt gefunden wurden. Bis auf zwei läppische Pressemitteilungen zu Gemälden von Matisse und Liebermann, zu deren Rückgabe noch Gurlitt selbst bereit gewesen war, wurden bislang keine Arbeitsergebnisse veröffentlicht, die für Restitutionen Relevanz hätten.
Kein einfaches Vermächtnis
Erben beraubter privater Kunstsammlungen dagegen warten zum Teil Monate darauf, bis sie auf ihre Anfragen von der Taskforce mehr als nur einen Formbrief mit Zwischenbescheid erhalten. Eine Anwältin, die die Erben eines jüdischen Sammlers vertritt, musste lange insistieren, bevor endlich ein Treffen mit dem Bearbeiter dieses Falles möglich war. Begrüßt wurde sie dann mit dem Hinweis, bislang lägen eigentlich überhaupt keine Hinweise darauf vor, dass der Sammler überhaupt ein Sammler gewesen sei. Als die Juristin auf zwei Fachaufsätze verwies, waren diese dem Bearbeiter offensichtlich völlig unbekannt, und sie wurde um Fotokopien gebeten.
Verschiedene Erbenvertreter sind auch mit ihrer Bitte gescheitert, die „Taskforce“ möge die ihr digital vorliegenden Geschäftsunterlagen der Familie Gurlitt berechtigten Anspruchstellern zugänglich machen. Aus ihnen könnten sich wichtige Hinweise auf die früheren Besitzer ergeben. Wegen der ungeklärten Erbfrage und angeblich zu wahrender Persönlichkeitsrechte wurde jede dieser Bitten mit gleichlautenden Briefen abgelehnt: Die Unterlagen seien Eigentum von Cornelius Gurlitt und nun seiner Erben - bis entschieden sei, wer das sei, dürfe nur der Nachlasspfleger entscheiden. Im November will das Kunstmuseum Bern, das von Cornelius Gurlitt testamentarisch als Erbe seines Kunstbesitzes eingesetzt wurde, erklären, ob es dieses nicht einfache Vermächtnis annimmt.
Lehnt es ab, würden noch lebende Verwandte des Sammlers erben. Weder sie noch der Berner Museumsdirektor Matthias Frehner - als ehemaliger Journalist selbst Autor eines Buches über NS-Raubkunst - widersprechen einer Offenlegung der Dokumente schon vor Klärung der Erbfrage. Die Taskforce sieht offenbar trotzdem sich selbst als zuständige Instanz an: Die Geschäftsunterlagen, wurde verschiedenen Anwälten mitgeteilt, würden schon einmal von zwei Mitarbeitern ausgewertet - allerdings nur, um die Provenienz der Sammlung Gurlitt zu klären. Eine entsprechende Aufarbeitung der längst digitalisierten Dokumente auch für Sammlererben scheint im Fall Gurlitt nach wie vor keine Option zu sein. Private Textstellen könnten ja unkenntlich gemacht, die Einsicht nur in einem Leseraum gewährt werden - so wie es in jedem seriösen Archiv die Regel ist. Die versprochene Transparenz sieht anders aus.
Öffnung der Archive
Dass dieses Vorgehen, das mehr mit Deutungshoheit, Besitzstandswahrung und Täterschutz als mit der angekündigten Transparenz und Opferhilfe zu tun hat, mit der möglichen Annahme des Gurlitt-Erbes durch das Kunstmuseum Bern beendet sein würde, ist allerdings fraglich. Aus der Schweiz ist zu hören, dass die deutsche Taskforce auch danach ihre Tätigkeit fortsetzen könnte: Schließlich wurde in Bern schon mehrfach betont, dass man für Provenienzforschung in Sachen Gurlitt keine eigenen Mittel aufbringen wolle. Also könnten zunächst nur jene Kunstwerke in die Schweiz reisen, bei denen ein Raubkunstverdacht ausgeschlossen werden kann. Alle anderen würde die Taskforce bewährt sorgfältig und ohne jedes Gespür für Zeitdruck so lange untersuchen, bis irgendwann feststehe, ob für die Werke eine „faire und gerechte“ Lösung gefunden werden müsste.
Die von Kulturstaatsministerin Monika Grütters geplante Stiftung kann nur dann sinnvoll sein, wenn mit der strukturellen auch eine inhaltliche Neuausrichtung einhergeht. Sechzehn Jahre nach der Washingtoner Erklärung gibt es längst viel zu viele Staaten im Staate und viel zu viele Provinzfürstinnen und -fürsten, die beim Thema NS-Raubkunst ihre Besitzstände und Deutungshoheit wahren wollen. Es darf nicht darum gehen, bislang Verantwortlichen, die ihrer Aufgabe nicht gerecht geworden sind, unter einem neuen Dach neue Posten zu geben.
Es muss wieder darum gehen, den Erben der NS-Opfer, soweit überhaupt noch möglich, zu ihrem Recht zu verhelfen. Und es muss darum gehen, den deutschen Museen in öffentlicher Trägerschaft ihre Rolle in diesem noch lange andauernden Prozess wieder vor Augen zu führen: Sie sind seit 1998 verpflichtet, ihre Archive zu öffnen und ihre Informationen zur Verfügung zu stellen. Wann und in welchem Maße sie das tun, darf nicht länger die Entscheidung der einzelnen Häuser sein. Die neue Stiftung muss hier endlich verbindliche und gegebenenfalls auch juristisch durchsetzbare Grundlagen formulieren, kontrollieren und durchsetzen. Sie braucht dafür eine starke Persönlichkeit an ihrer Spitze.
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/stiftung-zur-raubkunstaufklaerung-wann-gibt-es-endlich-resultate-13194854.html