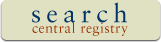News:
Wer hat mit diesen Löffeln gegessen? - Who ate with these spoons?
By Anna von Münchhausen
Viele Museen haben sich in der NS-Zeit aus jüdischem Besitz bedient. Jetzt stellt eine Schau im Museum für Kunst und Gewerbe unbequeme Fragen.

"Raubkunst? Provenienzforschung am MKG": Eine Ausstellung im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe
Vor Reuther liegen stumpfe Messer, verbogene Teelöffel und angelaufene Suppenkellen, die aussehen, als hätte jemand Omas Besteckschublade ausgekippt und als hätte Oma ihr Silber ewig nicht geputzt. Monatelang hat die Kunsthistorikerin die Geschichte des Bestecks recherchiert. Reuther ist Provenienzforscherin am Museum für Kunst und Gewerbe. Das heißt: Sie ermittelt die Herkunft – und vor allem die Vorbesitzer der Schätze des Museums.
Provenienzforschung, das kennt man aus der bildenden Kunst, aber Reuthers Schwerpunkt ist der angewandte Teil der Kunsthistorie. Ist das nicht langweilig, die Vergangenheit von Dingen zu durchleuchten, die aussehen wie Flohmarktkrempel? Keineswegs. Wer sich mit Reuther auf Spurensuche durch ihr Museum begibt, stößt auf Fragen und Geschichten, die dekorative Objekte mit Schicksalen verbinden. Vom 12. September an werden die Ergebnisse ihrer Forschung in einer Ausstellung gezeigt.
Das Museum für Kunst und Gewerbe, dieser cremefarbene Bau hinterm Hauptbahnhof, brummt in diesen Tagen. Japaner, Ostsee-Urlauber und Winterhuder Schulklassen flanieren durch die Säle, bewundern Madonnen und Gobelins, Silberpokale und französische Fayence, asiatische Teeschalen, Mode, Plakatkunst der zwanziger Jahre und, und, und. Rund 500.000 Objekte umfasst die Sammlung. 600 davon sind in der Zeit zwischen 1933 und 1945 angekauft worden.
Auf diese Zeit konzentriert sich die Schau unter dem Titel Raubkunst, auf Objekte also, die "NS-verfolgungsbedingt" enteignet wurden, wie die Provenienzforscher sagen. So war das auch mit dem Silber, das so flohmarktartig aussieht: Es stammt von jüdischen Familien, deren Besitz 1939 beschlagnahmt wurde. Als "Metallspende für das Reich" sollte es eingeschmolzen und in Waffenschmieden wiederverwendet werden. Zwei Museumsleiter prüften damals, ob manches davon interessant genug sei, um den Beständen einverleibt zu werden. Aber es häufte sich so viel an, dass sie nicht fertig wurden. Bei Kriegsende fanden sich nicht weniger als 30.000 Gegenstände im Tresorraum der Finanzdeputation, im "Silberkeller".
Die britische Militärregierung ordnete die Rückgabe der Schätze an die Enteigneten an. Aber das war nicht so einfach. Deswegen vereinbarte die Stadt Hamburg 1958 mit der Jewish Trust Conference einen Abgeltungsbetrag – schon der Begriff ein Euphemismus –, zu zahlen für Teile, deren Besitzer nicht mehr ausfindig gemacht werden konnten. Etwa eine Tonne Silber blieb übrig und wurde auf Hamburger Museen verteilt. Nie hervorgeholt, nie beforscht, nie bewältigt, sondern ratlos beschwiegen. "Es ist ein Ausgleich gezahlt worden – und trotzdem geht man mit diesem Silber nicht unbefangen um, man kann es nicht einfach so zeigen, es ist kein normales Sammlungsgut", sagt Reuther.
Doch nicht nur der Silberschatz, auch die 600 in der NS-Zeit gekauften Objekte sind eine Riesen-Herausforderung für die Provenienzforschung: Sind es Sammlerstücke, womöglich auch Gebrauchsgegenstände aus dem Besitz jüdischer Familien, die Geld für die Flucht benötigten? Sind es von dubiosen Kunsthändlern erworbene Objekte, die von längst in Konzentrationslagern verschwundenen Hamburgern stammten?
Diesen beklemmenden Fragen spürt Silke Reuther nach. "Wir nehmen diese historische Verantwortung ernst und beschäftigen uns mit unserer Sammlung: Wie sind die Exponate eigentlich hierher gekommen? Was für eine Geschichte haben sie? Welchen Kontext gibt es drum herum?", sagt sie. Ganz freiwillig hat diese Forschung nicht eingesetzt. 1998 hat Deutschland das Washingtoner Abkommen unterzeichnet. Es verpflichtet Museen, NS-verfolgungsbedingt enteignetes Kulturgut, insbesondere aus jüdischem Besitz, ausfindig zu machen und zurückzugeben.
Könnte auch die prächtig verzierte Tür aus Königsberg dazuzählen, ein Kleinod der Renaissance-Abteilung? Mit der Frage hat sich Silke Reuther eingehend beschäftigt, als die Galerie neu eingerichtet wurde. Ein merkwürdiger Fall. Bevor das prachtvolle Entree mit korinthischen Säulen, mit Schnitzereien und Intarsien aus Eichen-, Eschen-, Ahorn- und Zedernholz fest in den Räumen eingebaut wurde, wollte die Museumsleitung sicher sein, nicht plötzlich mit Ansprüchen von Enteigneten konfrontiert zu werden. Tatsächlich fand sich im Archiv eine alte Korrespondenz zu dem Ankauf. Eine Alice Aschmann aus Königsberg bot das außergewöhnliche Objekt dem Museum an – allerdings ging ausgerechnet ihr erster Brief verloren. "Man liest die Antwort des kommissarischen Museumsleiters Konrad Hüseler, der schreibt: Nein, wir haben kein Interesse, schon gar nicht zu diesem Preis", berichtet Reuther. Verdächtig schnell ließ sich die Verkäuferin dann auf einen deutlich niedrigeren Preis ein – und das im Jahr 1937. "Man merkt, Frau Aschmann muss um jeden Preis verkaufen", sagt Reuther. "Allerdings ließ sich kein jüdischer Kontext der Familie ermitteln, kein Zusammenhang, der auf Verfolgung schließen lassen musste."
Reuther fand heraus, dass Alice Aschmann 1970 in Hamburg verstarb. Mehr nicht. Die Forscherin entschloss sich daher, ein Foto der Tür mit dem, was sie wusste, auf der einschlägigen Website www.lostart.de zu veröffentlichen. Und tatsächlich, ein Münchner Journalist meldete sich: "Die Tür kenne ich." Aus Erzählungen. Alice Aschmann war seine Urgroßmutter, die nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes die Familie ernähren musste. Das war der Grund, weshalb sie sich schnell auf den heute als moralisch fragwürdigen bis schäbig geltenden Handel einließ. Kein politischer Hintergrund, aber ein Erwerb mit Beigeschmack. Auch die Geschichte der Königsberger Tür wird nun auf der Ausstellung erzählt. Startpunkt der Schau sind zwei Vitrinen im Foyer, in denen 100 bereits erforschte Objekte präsentiert werden. Anschließend wird der Besucher auf einen Parcours über alle Stockwerke geschickt, quer durch die Abteilungen des Hauses. Dort entdeckt er signalrote Hinweisschilder, sie deuten hier auf ein Vase, dort auf eine Bronze oder einen Pokal und erzählen, wie diese Objekte hierhergerieten.
Die Ausstellung ist der Versuch, endlich ein Tabu zu brechen und Sprachlosigkeit zu beenden. Die Geschichten der Kunstwerke lassen sich nicht einfach so in die Vitrine stellen, mit Schild versehen, Gegenstand, Material, Größe, fertig. Es muss erklärt werden, Zusammenhänge müssen aufgespürt, Biografien erzählt werden. Nichts ist so leicht zu erklären, wie es zunächst scheint. Ein Beispiel dafür ist die Sammlung Budge. Die Spuren des vermögenden jüdischen Sammlerpaars Henry und Emma Budge finden sich überall im Museum. Das Paar war aus den USA nach Hamburg gezogen und hatte 1910 das Palais Budge am Harvestehuder Weg bezogen. Emma Budge ließ sich von Justus Brinckmann beraten, dem Gründer des Museums für Kunst und Gewerbe. Später war sie mit dessen Nachfolger Max Sauerlandt befreundet. Sie war eine große Gönnerin des Museums, sie finanzierte Ankäufe, schenkte ihm Stücke aus ihrer Privatsammlung. Beispielsweise Inventarnummer 1931.210, das "kleine Kabinett", eine Art Mini-Kommode im Stil der Renaissance. Oder der kuriose Schellenbecher, "Süddeutschland, um 1550/1600", mit den kuriosen Glöckchen am Fuß, die jeden Griff zum Wein vermeldeten.
Doch auch hinter der Geschichte von Emma Budge steckt mehr. Noch 1933 verfügte sie in ihrem Testament, ihr Kunstbesitz solle ihrem Lieblingsmuseum zufallen. Als ihr Freund Max Sauerlandt wenige Wochen nach der Machtergreifung aus dem Amt gejagt wurde, änderte sie ihre Verfügung: Nichts, gar nichts solle Hamburg nun erhalten. Und was passierte? Nach ihrem Tod wurde ihr Hab und Gut mitsamt der Kunstsammlung aufgelöst, alles wurde 1937 versteigert, verstreut in alle Winde. "Eine Auktion, die heute klar als Zwangsverkauf eingestuft wird. Von den Erträgen landete nichts bei den Budge-Erben", sagte Reuther. Zweimal entschädigte die Stadt Hamburg die Erben seither.
Es sind diese Geschichten, die den Atem stocken lassen und die Ausstellung zu einem Erlebnis machen. Und die einem eine Ahnung geben: Für Silke Reuther und ihre Kollegen gibt es noch viel Arbeit.
"Raubkunst", Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz, ab 12. September, Di–So 10–18 Uhr, Do 10–21 Uhr. www.mkg-hamburg.de
http://www.zeit.de/2014/38/raubkunst-ausstellung-hamburg